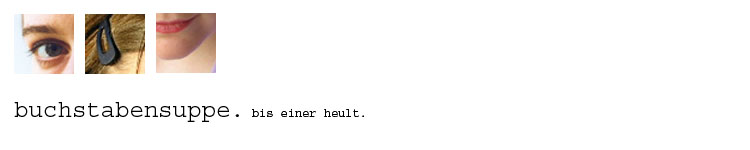... newer stories
Mittwoch, 28. Januar 2009

Die Tage vergehen langsam. Sie ziehen durch einen trägen Grauschleier aus Schmerz und Verzweifelung vernebelt an mir vorbei, einer wie der andere. Schon in den letzten Wochen habe ich gespürt, dass irgend etwas passiert, dass es sich ein bisschen wie früher anfühlt. Plötzlich ist da wieder so viel Traurigkeit, dass ich nur noch mit großer Mühe und Anstrengung die Fassung bewahren kann. Letztendlich sind es die Schmerzen der Krankheit, die dazu führen, dass es kein Halten mehr gibt, kein Zurück, dass das Unten einfach da ist.
"Meine Güte, du bist vollkommen neben der Spur", sagt der Philosoph ein wenig perplex am Telefon, als ich erst mit zittriger Stimme, später vollkommen aufgelöst, versuche eine Erklärung für mein Elend zu finden. Es ist kein Platz mehr für Spielerei, kein Platz für herausgeforderte Schmerzen und emotionale Unsicherheit, zumal von einem virtuellen Gegenüber. Ich verabschiede ihn aus meinem Leben und weiß, dass er über diese Entscheidung ebenfalls erleichtert ist.
Als wenig später der Papa anruft, rollen erneut die Tränen, kann ich vor Schluchzern kaum sprechen. Die Jobsituation, meine Furcht vor dem Leben, das vernichtende Gefühl der Unfähigkeit. Er versucht es mit liebevollen Worten und Geduld, mit einer Motivation zu kleinen und logischen Schritten. Aber es ist schwer gegen eine Verzweifelung zu argumentieren, wenn jedes Wort unmittelbar von der Resignation verschluckt wird.
Am nächsten Morgen sage ich der Ärztin wie es ist. Angst vor einem Nervenzusammenbruch, falls ich ihn nicht schon habe. Sie gibt mir die Adresse eines Arztes und schreibt mich krank, ob wegen des Magens oder wegen der Nerven ist egal. Nur Zwieback-Salzstangen-Fencheltee, das allerdings, hilft nur gegen das Bauchweh. Ich gehe nach Hause und heule weiter.
Wieder meldet sich der Papa, aber diesmal fragt er nicht erst wie es geht. "Opa ist gestorben", sagt er mit ruhiger Stimme und ist ganz gefasst. Zackbumm. Ich brauche gar nicht neu ansetzen, sondern heule einfach weiter, immer weiter und weiter, als könnte ich nie mehr damit aufhören. Opa. Mein kleiner Opa. Schau nur, wie viele Tränen ich habe.
Später ruft Mama an. Und endlich habe ich jemanden, mit dem ich gemeinsam weinen kann, mit dem ich trauern kann. Wir zünden Kerzen an, sie bei sich und ich bei mir. Wir erzählen uns Familiengeschichten. Geschichten über den Menschen, der so uralt geworden ist, der für uns alle der Fels in der Brandung war: immer da, immer guter Dinge, immer liebevoll. "Mein Vater ist wie mein Opa", sage ich zu meiner Mutter und im gleichen Augenblick tut es mir leid, weil wir beide wissen, dass ich das Liebevolle, das Aufmerksame, das Emotionale, das Gütige meine. Das, was ich ihr immer abgesprochen habe. Auch hier der Schmerz.
Ich merke das nichts stimmt. Nicht in mir drin und nicht um mich herum. Wenn es nach mir ginge, säße ich jetzt am Totenbett meines Opas, würde mit ihm reden, ihm Geschichten erzählen, meine Finger durch sein volles weißes Haar gleiten lassen, seine Wange streicheln, seine Hand halten, mit meiner Familie über u n s reden. Aber es ist alles anders, es ist alles falsch und ich sitze alleine zu Hause, blättere durch die Fotoalben meiner Kindheit und klicke mich durch die Bilder, die ich per Selbstauslöser am letzten Heiligabend von ihm und mir gemacht habe.
Wie eine Schallplatte mit Sprung, leiern immer wieder die Abschiedsworte des Philosophen durch meinen Kopf. "Denk dran, Baby, das Leben fickt uns alle in den Arsch. Aber für einen selber ist es eben immer am härtesten." Genau.
... older stories