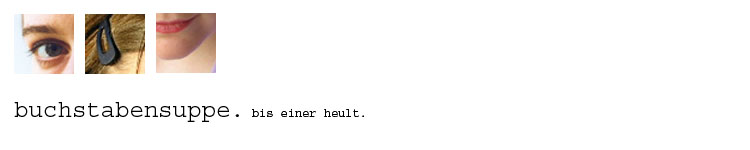... newer stories
Freitag, 23. Januar 2009
Er verliert einfach nicht seinen Reiz. So heftig ich auch mit dem Philosophen streite, so oft wir für gefühlte Ewigkeiten den Kontakt abbrechen, so viele Gemeinheiten wir uns auch an den Kopf werfen. Er taucht auf und ab, ist nah und fern, ist innig und fremd. Aber nie schaffe ich es, ihn ganz loszulassen, zumindest nicht in Gedanken. "Was willst du eigentlich von mir?", will er immer dann wissen, wenn wir uns wieder nahe kommen und stellt damit jedes Mal die schwerste aller Fragen. "Reden", sage ich ernst und er lacht.
Als ich ihm vom ersten Treffen mit dem Fremden erzähle wird er ungerecht und gemein. Wir brauchen eine Pause und Zeit zum Nachdenken, denn plötzlich stört jemand unsere virtuelle Idylle. Der Fremde nimmt einen Platz zwischen uns ein, ohne wirklich präsent zu sein. Aber dann folgt eine neue Annährung. Dieses Mal sind wir beide vorsichtig. Er fragt nach und ich erzähle, er hört geduldig zu, bis ich geendet habe. "Warum verschwendest du dich an so einen Mann? " Die Worte dröhnen in meinen Ohren, obwohl ich sie nur schwarz und weiß auf meinem Monitor geschrieben sehe. Ich schlucke schwer, denn in seinen Worten schwingt einzig und allein Besorgnis mit, keine Eifersucht. Er hat begriffen, dass ich mich einem Mann hingebe, der sich nicht für mich interessiert, für den ich eine unter vielen bin, mit der er das macht, was er mit allen macht. "Lass mich", sage ich brüsk, denn ich will nicht darüber reden, will nicht darüber nachdenken, will nicht die Schmerzen spüren, die mit diesem Gedanken verbunden sind. "Bist du dir nicht zu gut für sowas, Mädchen?", fragt er sanft und legt den Finger erneut in die Wunde. "Nein", gebe ich schnippisch zurück, "ich bin mir für nichts zu schade." Die Tränen in meinen Augen kann er nicht sehen und vielleicht beginnt er deshalb, über die Dialektik von Herr und Knecht zu sprechen, davon, dass ich den Fremden für meine Zwecke benutze. Der Philosoph beschreibt und charakterisiert in groben Zügen diese schmachvolle Verbindung. Es tut weh, aber ich kann an einem schwachen Tag wie diesem nichts erwidern, was der Sache die Schwere nehmen könnte. "Hör auf", will ich schreien, aber im Chat kommt meine sich überschlagende Stimme nicht bis zu ihm durch, so dass ich abwarten muss, bis er von selbst das Thema wechselt.
"Du wirst uns besuchen kommen", sagt er schließlich und ich nicke und tippe ein "ja" in das Dialogfenster. Ich will ihn endlich sehen, ihn umarmen, mich von ihm drücken lassen, mich mit ihm betrinken und reden bis zum Umfallen. Fotos und Webcam, Telefon und Chat. Das ist wenig, wenn man jemanden mag und ich kann diesem virtuellen Geschwurbel eher wenig abgewinnen. Ich will lebendige Menschen, will Gesichter, strahlende Augen, gekrauste Nasen, lachende Münder, Hände, die ich in meinen halten kann, Körper, die zum Anfassen echt sind. Ich mag diese virtuelle Identität nicht. Irgendwann muss man seinem Gegenüber wirklich nahe sein, um Nähe zu spüren.
"Wärst du sauer, wenn nichts passiert?", will er wissen. Tatsächlich denkt er auch nach Monaten noch, ich wäre ein sexgeiles Ungeheuer, das nur auf die nächste Gelegenheit wartet sich flachlegen zu lassen. Dabei will ich doch nur endlich seine weiche Seite kennelernen. Aber ich weiß, dass es bei solchen Begegnungen immer um Erwartungen geht, von denen man fürchtet, sie nicht erfüllen zu können. Das geht mir so, das geht ihm so und allen anderen wohl auch.
... older stories