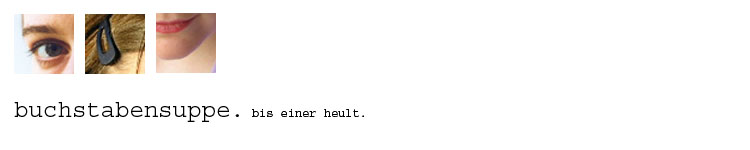... newer stories
Sonntag, 10. August 2008
Don't save me when I'm startin' to drown
Don't use me when you don't want me around
(Lime Spiders. Slave Girl)
Seit ich mich im Juni zum Szenetreff gewagt habe, kann ich nicht mehr davon lassen. Alles hat sich verändert, ist offener geworden, die Besucher scheinen jünger zu werden (ich älter) und die Lokalität bietet die Möglichkeit herumzustreifen und hier ein paar Worte zu wechseln, dort stehen zu bleiben, zu gucken, zu staunen, Kontakt aufzunehmen. Ich fühle mich dort nicht anders, obwohl ich fremd bin. Es gefällt mir.
Als ich die Bar betrete spüre ich das vibrierende Leben. Es ist fast ein bisschen wie früher, als ich noch so richtig dazu gehörte, denn ich werde bewunken, gedrückt und geküsst. Ein gutes Gefühl. Aber schwups, zieht mich eine alte Bekannte zur Seite, sie müsse mir etwas sagen. Der Ex sei da. Mein ganz persönliches Desaster2004, von dem noch ein riesiger Haufen Enttäuschung, Wut und schlechte Gedanken übrig geblieben sind. Verdammt. Was nun?

Dem Feind ins Auge blicken, entschließe ich mich, denn es ist ein besonderer Tag und vielleicht bringt er mir Glück. Ich drängele mich durch die Menschenmassen bis ich vor seinem Tisch stehe. Wir sehen uns an, prüfend und lange und dann lächele ich vorsichtig. Es ist ein Zeichen. Er steht auf und wir nehmen uns in die Arme. Mein Herz schlägt schnell, aber äußerlich bin ich die Ruhe selbst, als ich neben ihm auf die Bank rutsche.
Er sieht gut aus. Besser als damals. Gesund und attraktiv, ein smarter Frauentyp. Zu schade für eine allein, denke ich im Stillen. Wir beginnen zu reden, das können wir beide gut, und die Smalltalk-Themen ermöglichen uns einen vorsichtigen Abstand. Aber diese Art der Oberflächlichkeit ist nicht meins und nicht seins und so zupfe ich ihn schließlich am Ärmel und frage, ob wir vor die Tür gehen wollen. Frische Luft für einen großen Schritt. Wir setzen uns eng nebeneinander, Oberschenkel an Oberschenkel, Schulter an Schulter. Vielleicht ist es die körperliche Nähe, die uns wieder näher zueinander führt. Er erzählt und zeigt seine Schwächen ganz offen, macht sich durch Worte verwundbar und ich sehe in seinen Augen das Vertrauen funkeln, welches er mir zu Füßen legt.
Und dann fange ich an zu erzählen. Wie hart die Zeit war, die nach der Trennung folgte. Wie es immer schlimmer und schlimmer wurde. Seine Augen werden immer größer, er schüttelt fassungslos den Kopf und irgendwann kommen die Tränen. Er weint für mich und hält mich fest, die Arme um meine Schultern gelegt. Ich kann nicht glauben, was gerade passiert. Aus dem Arschloch von damals wird wieder der Mann, den ich begehrte, in den ich mich verliebt habe. Ich sehe wieder das Gute, das Liebenswerte an ihm und ich frage mich, wieso es nötig war, alles auszublenden, um ihn nur richtig hassen zu können.

Er erzählt mir von seiner Beziehung. Wie schwer es oft ist. Seine Ehrlichkeit tut mir so gut, denn wie hart wäre es gewesen, wenn er mir von einem großen Glückstaumel erzählt hätte. Stattdessen bleibt er bei der Wahrheit und ich höre zu, ganz ohne Groll, ganz ohne Neid. Aber was jetzt mit mir und der Liebe wäre, will er wissen. "Mich will keiner", sage ich und meine es so. "Also ich wollte dich, wenn du dich bitte daran erinnerst", sagt er und grinst. "Ich wollte dich sogar heiraten." Es ist ein bisschen lustig, als er das sagt, und wir müssen beide lachen. Heute ist der Abstand dafür groß genug, weil wir beide wissen, dass ich gute Gründe für das Nein hatte. Wir passen nicht zueinander.
Es wird eine lange Nacht. Wir reden über unsere Trennung und die Schmerzen, die überstanden werden mussten. Darüber, wie Kopfkino Menschen entfremden kann. Welche Fehler wir gemacht haben. Er seine und ich meine. Wie wir uns verloren haben, aneinander vorbeiredeten und uns ins Nirgendwo verliefen. Wie weh das Abschiednehmen tat und das Gefühl, den anderen verfluchen zu müssen. Seine Worte streicheln mein Herz.
Es ist, als hätte ich in meinem Lebensbuch zu einem früheren Kapitel zurückgeblättert. Wie durch ein kleines Wunder darf ich schlechte Zeilen ausradieren und korrigieren, durch neue, andere Worte ersetzen. Ich habe Erklärungen bekommen und konnte mein Bild gerade rücken. Er ist kein rücksichtsloser Idiot, kein egoistisches Arschloch, sondern er war damals genauso verzweifelt wie ich. Wie heilsam ist es, sich das einzugestehen zu dürfen.
Samstag, 9. August 2008

Am vorliegenden Material kein Anhalt für Malignität.
Pew.
Donnerstag, 7. August 2008
Mr. Sweet ruft an, noch halb im Urlaub, von der Autobahn aus. Ob ich Zeit hätte am Abend. Ich zögere für einen kurzen Moment, stimme dann aber zu. Die letzte Verabredung muss irgendwie überdeckt werden. Unsere Beziehung anders fortgesetzt werden. Freundschaftlich und ohne Hintergedanken.
"Ich komme zu dir", sagt er und der Unterton in seiner Stimme lässt mich hinzufügen: "Aber nur zum reden." Ganz, wie es seiner Art entspricht, schlägt er einen schmusigen Tonfall an. Ich bin enttäuscht. "Ich will nicht." Klipp und klar, für mich und für ihn. Offensichtlich reichen Signale nicht aus, es müssen klare Worte sein. "Schade, schade", sagt er sanft zur Verabschiedung, schade, schade, denke ich trotzig, nachdem ich den Hörer aufgelegt habe.
Lieber ein Date mit der Freundin. Sicher ist sicher. Zweideutigem Kram aus dem Weg gehen.
Mittwoch, 6. August 2008
Noch nie habe ich bei der Frau aus L. angerufen und gesagt: "Bitte 1 Termin für Zwischendurch." Kein Problem. Ich kann sogar wählen ob sofort oder später und schon sitze ich in ihrem lichtdurchfluteten Zimmer, während ein kühler Wind durch die weißen und flatterigen Vorhänge streicht und mein erhitztes Gesicht kühlt.
 Sie tut mir schon leid, bevor ich überhaupt anfangen habe. Alles bekommt sie mit Wucht vor die Füße geworfen und ein paar Tränen laufen mir die Wangen hinunter. Es ist ein großer Haufen Hoffnungslosigkeit und Verzweifelung. Sag was! Tu was! Erkläre mir die Welt! Rette mich! Ganz oben prangt das überdimensionale Fragezeichen, das bis in den Himmel reicht und ich blicke ins Leere und warte auf ein Ende.
Sie tut mir schon leid, bevor ich überhaupt anfangen habe. Alles bekommt sie mit Wucht vor die Füße geworfen und ein paar Tränen laufen mir die Wangen hinunter. Es ist ein großer Haufen Hoffnungslosigkeit und Verzweifelung. Sag was! Tu was! Erkläre mir die Welt! Rette mich! Ganz oben prangt das überdimensionale Fragezeichen, das bis in den Himmel reicht und ich blicke ins Leere und warte auf ein Ende.Wir schweigen. Und dann beginnt sie von der Traurigkeit zu sprechen. Davon, wie ich mich immer zurückhalte, abwiegele, mit aller Kraft verdränge, was ausgesprochen werden muss. Und selbst dann, wenn all die Worte schon irgendwann einmal gesprochen wurden, muss es noch einmal raus und vielleicht auch noch ein zweites, drittes, viertes Mal. Trauern, damit irgendwann Ruhe einkehren kann. Weinen, damit irgendwann der Abstand ausreicht, um die Vergangenheit gelassener zu nehmen.
Ich versuche ihr zu erklären, dass es möglicherweise kein Halten mehr geben wird. Dass ich mich im Tränenmeer ertrinken sehe, ohne Rettungsring, während das Wasser steigen und steigen wird, bis ich qualvoll am eigenen Elend verrecke. Weil ich weiß, dass kein Verlass auf diejenigen ist, die für das Retten mit Geld bezahlt werden. Und sie nickt und redet vom Krisendienst, dann, wenn gar nichts mehr geht, aber es fällt mir schwer an Hilfe zu glauben, wenn es eigentlich zu spät dafür ist.
Ich wünsche mir die Scheißegal-Laune herbei. Meine Worte werden immer eindringlicher. Ich will, dass sie es ausspricht. Mit ihr gemeinsam gehe ich Schritt für Schritt dem Endzeit-Szenario entgegen, bis sie schließlich die Möglichkeit in Erwägung zieht. Jedoch anders als erwartet. "Pillen decken die Traurigkeit zu. Das ist nichts für sie." Sagt sie einfach so. Weil ich an eben dieser Traurigkeit arbeiten muss. "Wir haben noch einen langen Weg vor uns." Herzkrampf. Gute Frau. Dankedankedanke.
Die Entscheidung treffen, Traurigkeit zuzulassen. Einen Schritt ins Ungewisse machen. Kontrollverlust gestatten. Das war noch nie meine Stärke. Ganz im Gegenteil.
Montag, 4. August 2008
Sanne am Sonntag. Unsere Verabredungen sind Expeditionen ins Ungewisse und ob ich will oder nicht, muss ich mich von ihr führen lassen. Durch zerbrechliches Gefühlswirrwarr und emotionale Gletscherspalten. Jedes Mal wieder, jedes Mal anders und jedes Mal begegnen wir uns neu.
Worte, die weh tun. Sanne spricht sie aus. "Was ist von unserem letzten Treffen bis heute passiert?", will sie wissen und ich zucke die Schultern und sehe die Tränen in ihren Augen, die eigentlich meine sind. "So hoffnungslos", stellt sie mit forschem Frageton in der Stimme fest und ich nicke. Weil ich an nichts mehr glauben kann. Nicht an unbeschwertes Beisammensein, nicht an die Liebe und schon gar nicht an den Unsinn, dass alles gut werden wird.
Ich bin Zuschauer und beobachte die anderen beim Leben, beim Verlieben, beim Glücklichsein. Ich stehe daneben und sehe zu, freue mich mit ihnen und wünsche ihnen alles Gute. Immer am Rand. Immer allein.
Sie nimmt mich in die Arme und es fühlt sich warm und nah und vertraut an. "Es ist doch nicht peinlich, sich jemanden an seine Seite zu wünschen oder eine Familie haben zu wollen." Sagt sie und ich will widersprechen. Einen Mann? Eine Familie? Ich bin doch nicht größenwahnsinnig, ich bin realistisch. Sie streicht mir sanft über das Haar. "Man kann auch dann die Augen offenhalten, wenn man nicht so genau weiß, was man eigentlich braucht", sagt sie und ich versuche zu nicken und muss die Tränen runterschlucken. Nicht einmal Alkohol hilft.
Ich möchte ihr glauben und kann es nicht.
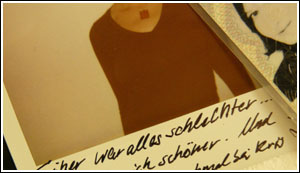 Auf dem Polaroid vom Abend sieht Sanne aus wie ein 70er Jahre Popstar. Ihr Worte lassen mich auch am Morgen danach noch einmal lächeln. Früher war alles schlechter... Und in ihrem Fall, scheint das tatsächlich zu stimmen. Wenn ich das doch auch irgendwann schreiben, sagen oder denken könnte.
Auf dem Polaroid vom Abend sieht Sanne aus wie ein 70er Jahre Popstar. Ihr Worte lassen mich auch am Morgen danach noch einmal lächeln. Früher war alles schlechter... Und in ihrem Fall, scheint das tatsächlich zu stimmen. Wenn ich das doch auch irgendwann schreiben, sagen oder denken könnte.Immerhin hat die Frau aus L. kurzfristig einen Termin frei. Soll sie mir doch sagen, was jetzt zu tun ist. Soll sie mir die Anleitung geben, wie ich meinen eigenen Abgründen entkommen kann. Ich fürchte nur, sie weiß auch keinen Rat. Am Ende steht man eben immer alleine da.
... older stories