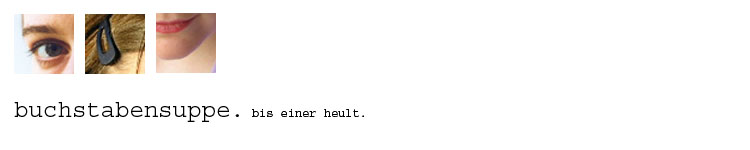... newer stories
Samstag, 17. Januar 2009
Das Krankenhaus kenne ich nach all den Jahren besser als mir lieb ist. Ich versuche es auf der üblichen Station. "Das letzte Zimmer", gibt die Schwester zur Antwort, "aber bitte nicht zu lange". Ja, ja. Ich betrete den kahlen, kalten Raum, der hell erleuchtet ist und in dem zwei Fernseher ohne Ton laufen, obwohl alle Patienten schlafen. Mein Opa liegt zusammengekauert unter einer Wolldecke. Er sieht winzig aus, das Gesicht ist eingefallen. Zum ersten Mal fällt mein Blick auf die eingesunkenen Augen und Wangen, an denen die Knochen stark hervortreten. Wie ein Totenschädel, der mit Reispapier bespannt ist.
Ich ziehe einen Stuhl an sein Bett und betrachte diesen vertrauten Menschen, der mich mein ganzes Leben lang begleitet hat. Mit den Fingerspitzen streiche ich über die Decke, seinen schmächtigen Körper entlang. Er schlägt die Augen auf, blinzelt, hebt den Kopf, lächelt mich an. "Dö-gö-nö", murmelt er kraftlos und ich brauche einen Augenblick, bis ich begreife, dass er meinen Vornamen genannt hat. "Opa", sage ich leise und küsse ihn auf die Wange, während ich sein Gesicht in meine Hände nehme. Der Schmerz will mir mit aller Macht die Tränen in die Augen treiben, aber ich bleibe hart, denn man kann nicht immer nur heulen.
Er beginnt zu reden, erzählt, fragt, sagt. Ich schüttele den Kopf, weil ich nicht verstehe, nicht erraten kann, was er meint. "Langsam", sage ich und er versucht mühsam die Worte zu formen und trotzdem sind die entstandenen Laute ein einziger Kauderwelsch. "Spät", verstehe ich schließlich und kann erleichtert ein "halb acht" antworten, während er lächelnd seinen Kopf in die Kissen zurücksinken lässt. Ich fange an von meinem Tag zu erzählen. Erst von der Arbeit, woraufhin er empört den Kopf schüttelt, dann, dass ich gerade mit der Tatze und dem Glitzerfunkelsternchen im Eisstadion war. Er versteht mich, das merke ich genau, er ist nicht verwirrt, sondern ganz klar im Kopf.
"Was kann ich tun, Opi?", frage ich ihn und reiche ihm sein Wasserglas. Er schluckt mühsam und ich tupfe die Flüssigkeit weg, die vom Mundwinkel auf seine Brust tropft. "Arme", verstehe ich anschließend, während er mir den Rechten entgegenhält und auf die Cremetube auf dem Nachttisch zeigt. Es ist gut etwas tun zu können. Seine Haut ist wie Seidenpapier, ganz fein und zart. Er wirkt zerbrechlich, als ich seine Arme in meinen starken Händen halte, die Creme verstreiche, sie vorsichtig einmassiere. Er gibt Laute von sich, als würde er schnurren und redet dabei immer wieder unverständliche Worte. "Rücken", sagt er dann und ich schiebe meine Hände unter den Krankenhauskittel, creme seinen trockenen Rücken ein, creme und creme und kann gar nicht mehr aufhören, weil ich mich einfach nicht losreißen kann, weil ich ihm nahe sein will und diese Cremerei so angenehm und zärtlich ist. Aber dann kommt die Schwester ins Zimmer und sagt, dass es Zeit ist zu gehen, dass ich ja morgen wiederkommen kann. Ja, ja.
Draußen ist es kalt. Die Stadt ist seit dem Tauwetter ekelhaft grau und schmuddelig. Durch Schneematsch und Dunkelheit laufe ich ins Nirgendwo, dorthin, wo ich eine S-Bahnstation vermute. Ich lasse die Erinnerungen von früher vorbeiziehen, an die vielen Jahre, die wir miteinander hatten. Gehen lassen ist so schwer.
... older stories