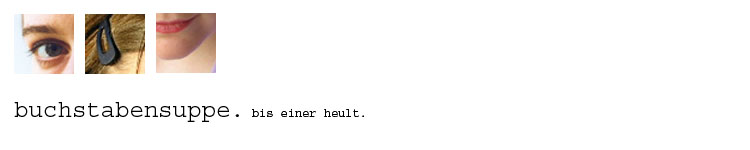... newer stories
Mittwoch, 1. Oktober 2008
Als ich den Hausflur vom Lieblingskollegen betrete, fühlt sich alles vertraut an. Schon bevor ich meinen Fuß auf die erste Stufe setze, höre ich Herrn Baby aufgeregt kreischen, der mit einem erwartungsfrohen Grinsen auf dem Absatz vor der Wohnungstür steht, eine Hand am Geländer, in der anderen eines dieser laut tönenden Gruselspielzeuge, das ich sofort bestaunen soll. Im Türrahmen erblicke ich das gleichen Grinsen in groß und der Kollege umarmt mich ein bisschen umständlich zur Begrüßung. Ich freue mich, die beiden wiederzusehen.
Als der Kaffee ausgetrunken und der Boden mit ausreichend Krümeln verziert ist, nehmen wir die Räder und fahren dorthin, wo es aussieht, wie auf dem Land. Es gibt massenhaft Grün, viele Tiere, zusammengenagelte Bretterbuden, ein knisterndes Lagerfeuer und viele Spielgelegenheiten für kleine Menschen. Wir stellen die Räder ab und Herr Baby nimmt erst seinen Vater bei der Hand und greift dann direkt nach meiner. Als wäre es ganz selbstverständlich. Als wäre es immer so gewesen. Die Geste läßt mich schwer schlucken und ich spüre diesen Anflug von schlechtem Gewissen, weil wir aussehen, wie eine Familie, obwohl wir keine sind. Wir schwingen Herrn Baby durch die Luft, bis er vor Vergnügen quietscht und ich frage mich, ob alle Menschen dieses Gefühl so glücklich macht.

Familie. Zusammen sein. Zusammen spielen, toben, radfahren, Neues entdecken, Eis essen, Tiere streicheln, Äpfel aufschneiden, Sandburgen bauen, gemeinsam klettern, Heimfahren, Abendbrot essen, malen, vorlesen, müde sein, Gutenachtkuss geben und kriegen.
So tun als ob. Der Nachhauseweg ist weit und lässt viel Zeit für Einsamkeit. Der Fahrtwind kühlt meine fiebrig heißen Wangen, aber die Traurigkeit pustet er nicht weg. Obwohl ich immer denke, längst darüber hinweg zu sein, kommen diese Momente immer wieder. Momente, in denen ich wünschte, ich müsste nicht nur so tun, als ob.
... older stories