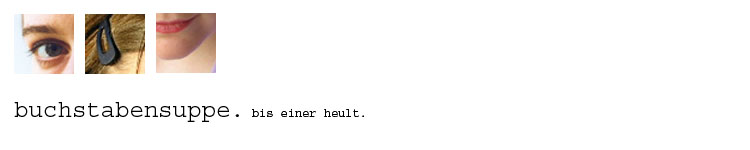Montag, 23. März 2009
Der Kontaktabbruch 2006/2007 hat dazu geführt, dass meine Mutter und ich sehr vorsichtig miteinander umgehen. Es lief immer auf die gleiche Weise ab: Sie war abwertend, ich nachtragend und jedes Schweigen dauerte viele Wochen lang.
Heute bemüht sie sich, mich freundlich zu behandeln. Heute bemühe ich mich, nachsichtig zu sein und nicht jedes Wort auf die Goldwaage zu legen.
Aber nun ist es wieder soweit. Die Situation meiner Arbeitslosigkeit ist für meine Mutter unerträglich. Das alte Muster wird hervorgekramt: Sie macht sich Sorgen, leidet unter schrecklichen Existenzängsten, beginnt zu Wehklagen, die sich zu Vorwürfen steigern, mischt sich ein, bewertet, verurteilt. Und kann keine meiner Bitten, das Thema zu wechseln oder gleich ganz auszuklammern, nachkommen. Als Quittung explodiere ich innerlich und gehe an die Decke, kann mich kaum zurückhalten vor Ärger und Wut. Das Gefühl, ein unmündiges und dummes Kind zu sein, das alles falsch macht, das keine Ahnung vom Leben hat, ist altbekannt. Es ist genau wie früher.
Ich will ruhig sein. Will ihr sagen, dass sie sich nicht einmischen soll. Will sie bitten, ihre vielen Sorgen und Ängste mit ihren Freunden zu besprechen, damit wir weiterhin friedlichen Kontakt haben können. Stattdessen grolle ich vor mich hin und habe einen Haufen Wut im Bauch. Das Telefon klingelt, bis der Anrufbeantworter ihre Nachricht entgegen nimmt, die Mails sammeln sich ungelesen und unbeantwortet Posteingang, während ich versuche meinen übermäßigen Zorn unter Kontrolle zu bringen.
Immer dasselbe.
Dienstag, 20. Januar 2009
Beim Kloppitreff erzählt die Eine, wie wichtig ihr Ehrlichkeit ist. Wie sie ihrer Freundin deshalb die Meinung gesagt hat: "Du siehst unmöglich aus, so gehe ich mit dir nicht auf die Straße." Während sie noch weiterspricht, braut sich in meinem Bauch ein dicker Wutklumpen zusammen, groß und böse. Die Eine plappert weiter und weiter bis ich sie mit einer mir fremden Stimme unterbreche. "Du wärst die längste Zeit meine Freundin gewesen." Sie sieht mich erschrocken an und schweigt.
Auf dem Heimweg versuche ich zu verstehen. Erinnere mich an ähnliche Aussagen über mein Aussehen. An Worte, die meine Mutter an mich richtete, vielleicht absichtlich, vielleicht auch sorglos, die ich nie vergessen werde, weil sie bis in alle Ewigkeit wirken werden. Und mir geht dieser eine Satz nicht mehr aus dem Kopf. "Wenn du 18 bist könnten wir (wir!) uns ja mal wegen einer möglichen Brustverkleinerung informieren." Ich war damals 14 oder 15 Jahre alt.
Seltsam, dass gerade diese Aussage mir im Kopf herumspukt, zwei Tage nachdem meine Brüste eine ganz zentrale Rolle im Spiel mit dem Fremden eingenommen haben. Nein, nicht seltsam, weil doch immer alles zusammenhängt. Man muss nur genau hinschauen.
Freitag, 3. Oktober 2008
Mama. Dieses heikle Thema. Von damals bis heute.
Ein Treffen. Nach sehr, sehr langer Zeit. Immerhin ohne schwierige Planung, ohne langatmige Telefonate, ohne vorbereitende Maßnahmen. Donnerstag? Passt.
Irgendwann sagte sie mal, dass es nicht gut wäre, wenn wir uns so lange nicht sehen würden. Weil mein Abneigung ihr gegenüber immer größer werden würde, sich unverhältnismäßig aufblähen würde, sie unmenschlich machen würde. Weil mir der Abgleich mit der Realität fehlt. Weil sie in meiner Phantasie zum hassenswerten Ungeheuer wird.
Ein bisschen hat sie recht. Denn als sie mir die Tür öffnet, sehe ich eine verwundete Kriegerin. Eine ermattete, aber schöne und stolze Frau mit tonnenweise Liebe in den Augen. Sie hält mich fest und hält mich fest und hält mich fest, bis ich mich sanft befreien muss, weil mir diese Nähe zuviel wird. Und gleichzeitig spüre ich den Schmerz der Entbehrung, weil ich so lange darauf verzichten musste.
Ich habe keine Ahnung, woher plötzlich diese Gelassenheit kommt, aber sie macht es mir möglich, das Treffen nicht nur zu ertragen. Keine falschen Worte. Kein Zorn. Kein Wälzen der Vergangenheit. Keine Vorwürfe. Keine Kritik. Gut machst du das, Mama, weiter so.
Zum Abschied nicke ich zu ihren Wünschen. Telefonieren & Treffen. Öfter & regelmäßig. Bitte. Ich schweige, denn ich will nichts versprechen, was ich nicht halten kann. Aber wir gehen mit einem guten Gefühl auseinander. Auf eine neue Chance, wie jedes Mal.
Mittwoch, 17. September 2008
Ich spreche wie eine gesprungene Schallplatte. Ich wiederhole, dass ich ein schlechtes Gewissen habe, weil ich mich nicht bei meiner Mutter melde. Die Frau aus L. spricht wie eine gesprungene Schallplatte. Sie wiederholt, dass die Zeit kommen wird, in der ich mich bei meiner Mutter melde. Oder auch nicht.
Also warte ich. Und versuche auf die Frau aus L. zu hören und vor allem, an ihre Worte zu glauben. Das schlechte Gewissen kommt und geht und kommt und geht. Je mehr Zeit verstreicht, desto kleiner wird das Gewissen und umso größer meine Vernunft und die Sorgfalt für mich selbst. Warum den Kontakt herbeiführen, der mehr schmerzt, als dass er gut tut. Warum sie und nie ich.
Heute eine Karte vom Bodensee. Sie ist mit einer Freundin unterwegs. Das Wetter ist gut. Die Tage sind herrlich. Wandern und Radfahren. Und natürlich liebe Grüße. Auch von Marion.
Beim Lesen wird mir das Herz eng. Ich weiß nicht, was für ein Gefühl dieses Ziehen verursacht. Vielleicht Wehmut? Vielleicht ein Anflug von Sehnsucht? Vielleicht doch wieder das schlechte Gewissen? Oder die alte Trauer? Aber immerhin spüre ich deutlich, dass da so etwas wie Freude ist. Darüber, dass sie an mich gedacht hat. An meinem Geburtstag hat sie keine Karte geschickt. Das tat so verdammt weh, dass ich auch nach Wochen noch nicht gut daran denken kann.
Aber jetzt ist da ein Gefühl, etwas zurückgeben zu wollen. Wenigstens ein kleines Hallo. Ich schlage die Tasten an, schnell, schnell, ohne Pause. Einfach ein paar Zeilen. Danke für die Karte. Alles ist gut. Freunde treffen, Kino, Café, Yoga. Arbeit besser als je zuvor. Vertrag wird für ein paar Monate verlängert. Liebe Grüße. Und drücke schnell auf Senden, womit meinem monatelangen Schweigen endlich ein Ende gesetzt ist. Zumindest für den Moment. Puh.
Freitag, 7. März 2008
Nach dem Tod habe ich das Gefühl, meine Mutter sprechen zu müssen oder zu wollen oder zu sollen. Wir haben seit vielen Monaten keinen Kontakt mehr, aber jetzt ist da etwas zwischen Wunsch und Pflichtgefühl, zwischen innerem Drang und objektiver Logik. Seit einer Woche nehme ich jeden Abend den Hörer zur Hand und lasse ihn doch wieder sinken, schaffe es nicht einmal die Nummer zu tippen. Warum geht es nicht? Was ist ein Telefonat verglichen mit dem Tod? Aber alles sträubt sich, Kopf und Herz und auch der verdammte Rest, denn ich habe Angst, ungreifbare und unaussprechliche Angst, auch wenn ich gar nicht weiß, was es eigentlich zu fürchten gibt.
Ihre eMails sind, ganz untypisch für sie, neutral gehalten. So neutral sie eben sein können, wenn die eigene Schwester gestorben ist und sich noch dazu die Tochter jeden Kontakt verbeten hat. In einem solchen Moment komme ich mir noch viel bösartiger vor, als ich es sein möchte. Hinterhältig und gemein, weil ich weiß, dass sie denkt, ich würde meine Schweigsamkeit zelebrieren, nur um ihr Schmerz zuzufügen. Dabei ist der Kontaktabbruch meine einzige Möglichkeit mich vor ihr zu schützen, so lange sie so stark und ich so schwach bin. Wir sind beide gefangen in unseren Gefühlen, die vor Jahren unsere Beziehung zueinander definierten - zu wenig gute, zu viele schlechte.
Ob wir zusammen zur Beerdigung fahren, fragt sie in ihrer eMail. Es wäre ein zusätzlicher Schmerz für mich, wenn wir getrennt voneinander in H. auftauchen würden, schreibt sie. Und schon laufen die Tränen, denn sie trifft einen wunden Punkt, der nicht nur sie schmerzt. Als Nicht-Familie zur Familie fahren - ein Szenario, so furchterregend und grässlich, das ich es mir nicht vorstellen mag. Aber ein Anruf macht nicht alles wieder heil und der schwere Stein im Magen wiegt so schwer, zu schwer, als dass ich ihn einfach wegschieben könnte. Ich lese von einem Blumenschmuck mit unser beider(?) Namen, eine logistische Frage, aber mein Herz krampft sich zusammen, weil ich immer nur daran denken kann, was wäre, wenn sie es wäre.
Meine Mutter wollte immer eine gute Mutter sein. Da bin ich ganz sicher, auch wenn ich es immer wieder vergesse. Sie wollte eine gute Mutter sein, ganz sicher, e i n e g u t e M u t t e r. Und nur weil ich denke, dass sie das nicht geschafft hat, ist es noch lange kein Grund dafür, mich wie eine schlechte Tochter aufzuführen und ihr all das an Gefühlen heimzahlen zu wollen, was sie mir vor Jahren zugefügt hat.