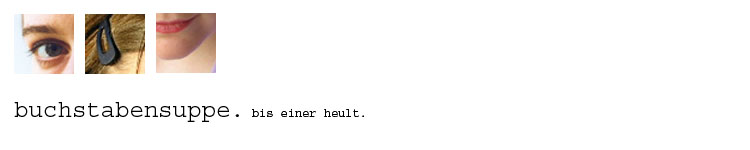... newer stories
Sonntag, 1. Februar 2009
Das Treffen mit dem Fremden kommt auch dieses Mal kurzfristig zustande. Das bedeutet, dass ich auf den Großteil der Vorfreude verzichten und mich außerdem in Geduld üben muss. Wie immer habe ich während der Zeit des Wartens mit heftigen Gefühlsregungen zu kämpfen, die von einem Extrem ins andere schwanken. Während in einem Moment noch Sehnsucht und Verlangen im Vordergrund stehen, ist im nächsten Augenblick konsequente Ablehnung vorherrschend. Aber ich lerne. Ich atme tief durch, lenke mich ein bisschen ab, bewerte die Situation erst, wenn ich wieder klar denken kann. Diese emotionalen Schnellschüsse haben nichts mit dem Fremden selbst zu tun sondern liegen in meiner Natur.
Als ich ihn sehe ist alles gut. Es ist ein bisschen wie heimkommen. Oder ankommen. Im Flur lege ich meine Tasche und meinen Mantel ab und betrete das Zimmer. Das Ritual am Anfang ist immer gleich. Er lächelt mir zu, legt mir eine Decke auf meinen Platz und wir betreten diese andere Welt. Es gibt nur noch das Jetzt, in dem sich trotz Auf- und Erregung eine vollkommene Ruhe in mir ausbreitet. Nur noch Sein. Ich atme die Stille, die mich umfängt, die Konzentration auf ihn & mich, weil es nur diesen einen Moment gibt und kein Platz für andere Gedanken übrig ist. Weil hier, bei ihm, der Raum für einen Teil von mir ist, der sonst nicht sein darf. Dem er ein Zuhause gibt.
Der Fremde balanciert mit großer Sicherheit die Rollen aus, spürt mich, fühlt meine Bedürfnisse und meine Verwundbarkeit, fragt nach meinen Wünschen und packt meine Seele an der Stelle, wo sie am zerbrechlichsten ist, mit starken sanften Händen, behutsam und vorsichtig, aber auch unnachgibig und fordernd. Er lässt nicht locker, wenn es sein muss. Er lässt locker, wenn es sein muss. Mein Vertrauen in ihn ist vollkommen.
Ob ich sauer war, will er wissen. Er meint die Zeit, zwischen den beiden Treffen, in denen ich ihn mehrmals um Termine gebeten habe. "Ja", sage ich ehrlich und wir reden über Eifersucht auf Menschen und auf die mit anderen verbrachte Zeit. Aussprechen was schmerzt, was weh tut, auch wenn es sich nicht ändern lässt.
Dieses Mal will ich nicht reden, will nicht denken, will nur spüren. Ich schließe die Augen, will nicht einmal sehen, weil ich mir dann selbst peinlich bin. Aber er lässt es nicht zu, denn es geht auch darum, Dinge bewußt zu tun, sich für sie zu entscheiden, wahrzunehmen, nachzuspüren, mit allen Sinnen. Sich all den widerstreitenden Gefühlen im eigenen Innern zu stellen. Zu seiner eigenen Leidenschaft zu stehen. Überhaupt: L e i d e n schaft.
Zum Glück redet er. Am liebsten würde ich all seine Worte irgendwo speichern, aufbewahren, damit ich sie später noch einmal anhören kann. Er fragt, was ich am Vorabend gemacht habe und ich muss lachen, denn es war der Abend mit dem Beuteschema, wie passend. Als ich ihm den Namen des Etablissements nenne wird er aufmerksam, lacht, erzählt. Der Fremden kennt mich mittlerweile ein bisschen, benutzt seine Fragen geschickt, spielt mit mir und ich nicke und erröte und liebe ihn für seine Aufmerksamkeit. Offenheit und Ehrlichkeit in allen Bereichen. Das gilt für ihn und für mich. Das ist immer das Beste. Die Basis.
Beim Abschied bin ich glücklich. Sicher. Die Ruhe bleibt auch danach noch lange in mir. Dieses Treffen war eine klare Entscheidung für ihn. Ich will mehr. Mit ihm. Und ich weiß, er wird es mir geben.
Samstag, 31. Januar 2009
Mit der Familie reden. Mit Papa, mit Mama, mit der armen Tante. Ich spüre eine Verbundenheit mit jedem von ihnen. Spüre Nähe und Geborgenheit. Es fühlt sich richtig an, vertraut und sicher.
Ich muss den Opa verabschieden. Ihm ein letztes Mal durch das Haar streichen, ein letztes Mal seine Wange berühren, ein letztes Mal ein "ich liebe dich" ins Ohr flüstern. Küssen kann ich den kalten Körper nicht mehr. Es ist nicht zu übersehen, dass das, was dort liegt, nur noch eine Hülle ist. Tot. Ich wäre gerne früher bei ihm gewesen.
Danach sind wieder die lebendigen Familienmitglieder an der Reihe. Es geht darum, gemeinsam zu planen und zu überlegen, wie es jetzt weitergeht. Es ist anders als noch vor ein paar Jahren. Die Familie sieht mich jetzt als Erwachsene. Ich übernehme Aufgaben, kümmere mich, sorge mich, kläre. Ich bin diejenige, mit der meisten Energie, die, die am ehrlichsten deutliche Worte sprechen kann, weil die anderen miteinander zu viel Rücksicht nehmen (müssen) und miteinander furchtbar verstrickt sind.
Aber es wird. Wir werden gemeinsam Lösungen finden, die unsere Probleme beheben. Und einen Weg, die restliche Familie zusammenzuhalten.
[Edit: Nichtsahnend die Fotos des vergangenen Abends hochladen wollen und die letzten Bilder vom Opa finden. Puh.]

Donnerstag, 29. Januar 2009
Was hilft? Beschäftigung. Arbeit. Dinge tun, die mich voranbringen. Dinge erledigen, die seit Wochen und Monaten darauf warten getan zu werden. So fällt stückchenweise Last von mir ab. Telefonate, Überweisungen, Briefe. Ordnung schaffen. Sortieren und wegwerfen. Entrümpeln. Erledigen. Abhaken.
Und dann? Gehe ich aus. Ich brauche Menschen um mich herum. Brauche Ablenkung. Der Szenetreff ist mein Ort, um in eine andere Welt einzutauchen. Während ich von einem Sessel aus die Menschen beobachte, betritt das Beuteschema den Raum. Er kommt näher, grüßt freundlich, setzt sich mir gegenüber, beginnt zu reden, lächelt mich an, fängt an zu flirten, fährt mit der Hand meinen Oberschenkel entlang, bezaubert mich mit seinem Strahlen, erzählt weiter, streicht mir über die Wange, regt mit seinen Worten mein Kopfkino an, bringt mich zum Erröten, greift mir lächelnd an die Brust, verführt mich, ehe ich es mich versehe. Ich bin hin und weg.
Und dann? Knutsche ich seit vier Jahren zum ersten Mal wieder. Alle Traurigkeit löst sich auf. Erleichterung. Befreiung. Hilfe, ein Prinz, denke ich, fange an zu kichern und setze mich breitbeinig auf seinen Schoß. Brust an Brust, Stirn an Stirn. Ich lasse mich fest im Nacken packen, mich in den Hals beißen, mich küssen bis zur Atemlosigkeit, während er mir zwischen die Beine greift, mich liebkost, mir Schweinereien ins Ohr flüstert. Irgendwann lehne ich erschöpft meinen Kopf an seine Schulter und atme langsam ein und aus. Das ist auch das Leben. Dann lege ich mein Ohr an seine Brust, lausche seinem Herzschlag und alles wird ruhig, alles klopft im Takt. Es ist gut, wie es ist, ist es gut.
Die Welt rückt langsam wieder zurecht.
Mittwoch, 28. Januar 2009

Die Tage vergehen langsam. Sie ziehen durch einen trägen Grauschleier aus Schmerz und Verzweifelung vernebelt an mir vorbei, einer wie der andere. Schon in den letzten Wochen habe ich gespürt, dass irgend etwas passiert, dass es sich ein bisschen wie früher anfühlt. Plötzlich ist da wieder so viel Traurigkeit, dass ich nur noch mit großer Mühe und Anstrengung die Fassung bewahren kann. Letztendlich sind es die Schmerzen der Krankheit, die dazu führen, dass es kein Halten mehr gibt, kein Zurück, dass das Unten einfach da ist.
"Meine Güte, du bist vollkommen neben der Spur", sagt der Philosoph ein wenig perplex am Telefon, als ich erst mit zittriger Stimme, später vollkommen aufgelöst, versuche eine Erklärung für mein Elend zu finden. Es ist kein Platz mehr für Spielerei, kein Platz für herausgeforderte Schmerzen und emotionale Unsicherheit, zumal von einem virtuellen Gegenüber. Ich verabschiede ihn aus meinem Leben und weiß, dass er über diese Entscheidung ebenfalls erleichtert ist.
Als wenig später der Papa anruft, rollen erneut die Tränen, kann ich vor Schluchzern kaum sprechen. Die Jobsituation, meine Furcht vor dem Leben, das vernichtende Gefühl der Unfähigkeit. Er versucht es mit liebevollen Worten und Geduld, mit einer Motivation zu kleinen und logischen Schritten. Aber es ist schwer gegen eine Verzweifelung zu argumentieren, wenn jedes Wort unmittelbar von der Resignation verschluckt wird.
Am nächsten Morgen sage ich der Ärztin wie es ist. Angst vor einem Nervenzusammenbruch, falls ich ihn nicht schon habe. Sie gibt mir die Adresse eines Arztes und schreibt mich krank, ob wegen des Magens oder wegen der Nerven ist egal. Nur Zwieback-Salzstangen-Fencheltee, das allerdings, hilft nur gegen das Bauchweh. Ich gehe nach Hause und heule weiter.
Wieder meldet sich der Papa, aber diesmal fragt er nicht erst wie es geht. "Opa ist gestorben", sagt er mit ruhiger Stimme und ist ganz gefasst. Zackbumm. Ich brauche gar nicht neu ansetzen, sondern heule einfach weiter, immer weiter und weiter, als könnte ich nie mehr damit aufhören. Opa. Mein kleiner Opa. Schau nur, wie viele Tränen ich habe.
Später ruft Mama an. Und endlich habe ich jemanden, mit dem ich gemeinsam weinen kann, mit dem ich trauern kann. Wir zünden Kerzen an, sie bei sich und ich bei mir. Wir erzählen uns Familiengeschichten. Geschichten über den Menschen, der so uralt geworden ist, der für uns alle der Fels in der Brandung war: immer da, immer guter Dinge, immer liebevoll. "Mein Vater ist wie mein Opa", sage ich zu meiner Mutter und im gleichen Augenblick tut es mir leid, weil wir beide wissen, dass ich das Liebevolle, das Aufmerksame, das Emotionale, das Gütige meine. Das, was ich ihr immer abgesprochen habe. Auch hier der Schmerz.
Ich merke das nichts stimmt. Nicht in mir drin und nicht um mich herum. Wenn es nach mir ginge, säße ich jetzt am Totenbett meines Opas, würde mit ihm reden, ihm Geschichten erzählen, meine Finger durch sein volles weißes Haar gleiten lassen, seine Wange streicheln, seine Hand halten, mit meiner Familie über u n s reden. Aber es ist alles anders, es ist alles falsch und ich sitze alleine zu Hause, blättere durch die Fotoalben meiner Kindheit und klicke mich durch die Bilder, die ich per Selbstauslöser am letzten Heiligabend von ihm und mir gemacht habe.
Wie eine Schallplatte mit Sprung, leiern immer wieder die Abschiedsworte des Philosophen durch meinen Kopf. "Denk dran, Baby, das Leben fickt uns alle in den Arsch. Aber für einen selber ist es eben immer am härtesten." Genau.
Dienstag, 27. Januar 2009
Mein letzter Opa. Mein Lieblingsopa.
Ich bin so traurig.
... older stories