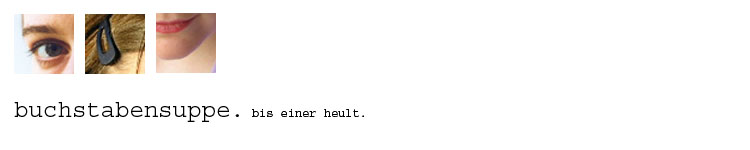Samstag, 31. Januar 2009
Mit der Familie reden. Mit Papa, mit Mama, mit der armen Tante. Ich spüre eine Verbundenheit mit jedem von ihnen. Spüre Nähe und Geborgenheit. Es fühlt sich richtig an, vertraut und sicher.
Ich muss den Opa verabschieden. Ihm ein letztes Mal durch das Haar streichen, ein letztes Mal seine Wange berühren, ein letztes Mal ein "ich liebe dich" ins Ohr flüstern. Küssen kann ich den kalten Körper nicht mehr. Es ist nicht zu übersehen, dass das, was dort liegt, nur noch eine Hülle ist. Tot. Ich wäre gerne früher bei ihm gewesen.
Danach sind wieder die lebendigen Familienmitglieder an der Reihe. Es geht darum, gemeinsam zu planen und zu überlegen, wie es jetzt weitergeht. Es ist anders als noch vor ein paar Jahren. Die Familie sieht mich jetzt als Erwachsene. Ich übernehme Aufgaben, kümmere mich, sorge mich, kläre. Ich bin diejenige, mit der meisten Energie, die, die am ehrlichsten deutliche Worte sprechen kann, weil die anderen miteinander zu viel Rücksicht nehmen (müssen) und miteinander furchtbar verstrickt sind.
Aber es wird. Wir werden gemeinsam Lösungen finden, die unsere Probleme beheben. Und einen Weg, die restliche Familie zusammenzuhalten.
[Edit: Nichtsahnend die Fotos des vergangenen Abends hochladen wollen und die letzten Bilder vom Opa finden. Puh.]

Montag, 12. Januar 2009
Eine Woche: Drei Tage in der Anstalt. Eine Käseplatte mit Mimi und ein Besuch beim Italiener mit dem I-Punkt. Der Kloppitreff. Vier Yogastunden. Ein Besuch beim Opa. Zweimal Schlittschuhlaufen mit der kleinen Miss. Eine lange, flirtreiche Nacht beim Szenetreff. Ein Nachmittagabend mit der Tatze und ihrer Tochter, dem Glitzerfunkelsternchen. Ein Frühstück mit Mr. Sweet und Kaffeetrinken mit Papa. Zwei lange, schöne Telefongespräche mit Freunden und ein holpriges mit einem Unbekannten. Chatten, Mailen, Bloggen, Surfen.
Trotzdem scheint die verbleibende Zeit unendlich. Stunden, in denen die Gedanken um den Fremden kreisen. Um Wünsche und Bedürfnisse, Ansprüche und Hoffnungen, Wissen und die Realität. Seit unserem ersten richtigen Treffen ist eine Woche vergangen und wir haben in den letzten Tagen nur wenige Worte per Mail gewechselt. Zu wenige, für meinen Geschmack. Ich bin unsicher, fürchte Zurückweisung, Ablehnung, Gleichgültigkeit. Ich bin in einer Rolle gefangen, die mir fremd ist, die mir Angst macht und mich in die Defensive drängt.
Unsere Distanz hat eine erregende Wirkung. Der Reiz liegt darin, dass der Fremde absolut nichts über mich weiß, außer meinen erotischen Fantasien. So bekommt die ganze Liaison einen etwas schmuddeligen und billigen Beigeschmack, der mir durchaus gefällt, den ich reizvoll und anziehend finde. Er schlägt ein weiteres Treffen in der nächsten Woche vor, umreißt kurz das Setting, dem ich zustimmen soll. Es gibt kein Wunschkonzert für mich, aber er will es so und das reicht aus. Noch Stunden nach meiner Zusage spüre ich meinen aufgebrachten und empörten Verstand auf mein Gewissen einwirken. Ich bin entsetzt, dass es keinerlei Zwang seinerseits bedurfte, keinerlei Überwindung meinerseits, um das ja in die Antwort zu tippen, mit dem ich auch dieses Mal meine selbstauferlegten Tabus brechen werde.
Trotzdem. Ich kann ihn nicht abstellen, den Wunsch nach mehr. Den Wunsch nach Seele, nach Nähe, nach Austausch. Ich will ihn kennenlernen, will ihn ganz, nicht nur diese eine Facette des Sexuellen und Abnormen. Ich will hinter die Fassade schauen, will ihn spüren, seine Abgründe erkunden, seine Stärken und Schwächen verehren (ich liebe sie einfach zu sehr, die menschlichen Schwächen), will wissen, welche Gedanken ihn am Tag begleiten und welche in der Nacht. Will ihm gefallen und an seiner Seite knien, bei ihm sein, seinen Kopf auf meiner Brust spüren, seinen Atem in meinem Nacken, seine Hände überall, mein Gesicht in seinem Herz vergraben.
"Hör auf mit diesem schrecklichen Liebesgefasel", sagt der Süd-Mann in strengem Ton.
"Ich höre auf mit dem Liebesgefasel", echoe ich und versuche es. Versuche es wirklich.
Dienstag, 30. Dezember 2008
Frau Spieß ist ins normale Leben zurückgekehrt. Knoten rausgeschnitten, Chemotherapie, Reha. Ratzfatz ging das.
"Geheilt", behaupten die Ärzte.
"Hoffentlich", sagt Frau Spieß.
"Bitte", denke ich.
Das Jahr neigt sich dem Ende zu und wir lauschen der Klavierspielerin in der anderen Ecke des Raumes. Kaffee und Torte werden gebracht. Sonntagsstimmung zum Jahresende.
"Was ist mit dir?" unterbreche ich schließlich die Stille am Tisch, aber Frau Spieß sitzt da, schweigt weiter und schaut wie ein zerrupftes Vögelchen ins Leere. "Alles scheiße?", frage ich vorsichtig und sie nickt ergeben, während sie plötzlich hektisch in ihrer Tasse rührt.
Frau Spieß ist alt. Jedenfalls denkt sie das. Sie ist der festen Überzeugung, dass jetzt nichts mehr kommt. Bei ihrer Lebensweise könnte sie damit durchaus recht behalten. Sie erzählt, dass sie sich eine Wohnanlage für Senioren angesehen hat. "Bist du dafür nicht ein bisschen zu jung?", frage ich in mühsam neutralgehaltenem Tonfall. Sie ist es tatsächlich, man darf erst ab 60 dort einziehen. Ich schüttele innerlich den Kopf. In Gedanken vergleiche ich sie mit meiner Mutter und wundere mich, wie unterschiedlich Menschen altern können.
"So geht das nicht weiter", sage ich schließlich im Lehrerinnentonfall, denn manchmal hilft nur konsequente Strenge. Frau Spieß nickt mit flehendem Blick. Ich erzähle ihr von Ehrenamtlichenbörsen und vom Großelterndienst, von Nachbarschaftsheimen und Sportangeboten, von Kursen an der Volkshochschule und allerlei anderem Kram. Sie hört zu, erst kopfschüttelnd, dann mit langsam erwachendem Interesse. "Eine Aufgabe wäre vielleicht gar nicht so schlecht", sagt sie dann und fragt noch die ein und andere Sache, so dass ich merke, dass sie tatsächlich meinen Worten gelauscht hat. Sie fängt Feuer, ich merke es genau. Wir beginnen auszuwählen und zu planen.
"Da trinken wir einen drauf", sagt sie eine Stunde später und bestellt zwei Prosecco. Und ich nehme mir vor, sie im Januar so lange zu trietzen, bis sie wirklich eine Sache in Angriff genommen hat, wenigstens eine, damit sie endlich mal rauskommt aus ihrer piefigen Butze. Herrje, das habe ich doch selber alles durch, das will ich nicht bei anderen sehen.
Sonntag, 21. Dezember 2008
"Hallo, mein kleines Schätzchen." So begrüßt mich mein Vater am Telefon. Jedes Mal. Es ist schön, dass er mich immer noch so nennt, auch wenn ich längst zu einem großen Schatz herangewachsen bin.
Er redet ein bisschen über das gestrige Familientreffen, von seinem schlechten Gesundheitszustand und dass er der kleinen Miss nicht beim Weihnachtssingen zuhören konnte, weil alles anders lief als geplant. Es sind noch fünf Tage bis Heiligabend und bisher haben wir es beide vermieden, das Thema anzuschneiden, das für uns so schwer zu besprechen ist. Ich habe mich entschieden, in diesem Jahr dem Familienzirkus zu entgehen, mit dem Vorsatz, eine Begegnung mit der Frau zu vermeiden. Sie ist es, die jedes gemeinsame Beisammensein durch ihre Launen bestimmt und der es oft genug gelingt, die Stimmung aller Anwesenden komplett zu ruinieren, auch wenn wir anderen hartnäckig mit unseren Sonnenscheingemütern dagegenhalten.
Der eigentliche Plan war, meinem Vater diese Entscheidung mitzuteilen. Aber stattdessen frage ich lahm und durch die Philosophengeschichte reichlich mitgenommen: "Und was ist mit Weihnachten?" Erstmal sagt er nicht viel, schlingert unsicher herum, um sich langsam vorzutasten, bis es schließlich heraus ist. "Du kannst Weihnachten nicht kommen." Es von ihm zu hören, hinterläßt ein anderes Gefühl, als wenn ich die Entscheidung selbst mitgeteilt hätte. Es tut weh. Aber wenigstens ist es heraus und er kann nicht einfach so tun, als wäre alles in Ordnung. Wir spüren beide, dass es die Sache auf die Spitze treibt, dass es schonungslos die krankhafte Beziehung der beiden offenlegt.
Ach Papa. Wie gerne würde ich dir ein wenig von meiner Stärke und Konsequenz abgeben, damit du endlich den Schritt machen kannst, dieses Desaster zu beenden.
Samstag, 11. Oktober 2008
Der Familientherapeut hört sich die Situation an. Er nickt, faltet die Hände, schaut mich an und schweigt. "Ausreden...", sagt er schließlich und seine sonst so verschmitzt aussehenden braunen Augen blicken mich ernst an. "Wovor schützen die dich?", sagt er fragend, damit ich für mich selbst eine Antwort finden kann. Dann sagt er noch ein paar allgemeine Dinge, die nicht so nett und auf mich bezogen sind und die er nur sagen darf, weil ich seine Freundin und nicht seine Klientin bin. Darüber, dass manche Menschen sich aus Feigheit selbst bescheißen. Darüber, dass manche Menschen immer aufgeben, wenn sie ein Risiko eingehen müssen. Darüber, wie verkehrt die Welt manchmal ist.
Ich weiss doch selbst nicht, was ich will. Jedenfalls nicht länger als fünf Minuten.
Freitag, 10. Oktober 2008
Heute bin ich schief. Ich finde mein Gleichgewicht nicht. Der Schwerpunkt hat sich in nichts aufgelöst und ich stehe unsicher auf wackeligen Beinen und versuche einen Punkt zu fixieren, um mich selbst darin zu finden.
Es zieht mich mal zu einer Seite, mal zur anderen Seite. Ich versuche vorsichtig dem Druck nachzugeben, beuge ich mich ein Stückchen in die gefühlte Richtung und bin schon zu weit, verliere das Gleichgewicht, stolpere, muss mich fangen. Mühevolles Stillstehen für einen langen Moment.
"Bleib bei dir", sagt der Lehrer, aber alles fühlt sich falsch und schief und schlecht an. Ich habe Schmerzen, die meine Gedanken nicht ruhen lassen und ich sehne mich nach einer freundschaftlichen Hand, an der ich mich festhalten kann, einem freundschaftlichen Wort, an das ich glauben kann. Es ist nur heute so, spreche ich mir in Gedanken Mut zu. Nur heute. Nur heute, echot es höhnisch.
Der Verstand streikt mit einer Vehemenz, dem die Vernunft nichts entgegenzusetzen hat. Aber nur heute. Hoffentlich.
Dienstag, 19. August 2008
Immerhin. Die Traurigkeit sitzt nicht länger nur in der Tiefe. Etwas hat sich auf den Weg an die Oberfläche gemacht. Langsam mache ich mir doch Sorgen, ob es wirklich das ist, was mir auf Dauer gut tut oder doch nur das, was mich wieder zurückdrängt in eine passive Lethargie.
Der Kloppi-Treff hält eine neue Herausforderung bereit. Es ist nur eine klitzekleine Frage, die mich mit einer Heftigkeit anspringt, mich überrumpelt und mir einen Sack über den Kopf stülpt. Dunkelheit und Rückblende. Ich erinnere mich an mehrere Situationen aus meiner Kindheit, schambesetzte Schrecklichkeiten, heimlich und peinlich. Mir läuft ein Schauer den Rücken herunter, während ich diese Erinnerung betrachte. Wie ich war. Was ich tat. Ich betrachte mich mit den Augen meiner Mutter - voller Abscheu, Ekel, Entsetzen. (Es dauert Stunden, bis jetzt, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich es aufschreibe, dass sich die Scham für dieses kleine Kind in Mitleid auflöst.)
Im Anschluss an das Treffen, an einem anderen Ort, komme ich kaum zur Ruhe. Da, wo ich sonst den Kopf mühelos abschalten kann, wo ich mich nur auf meinen Körper und sonst gar nichts konzentriere, schwirrt dieses Unruhegefühl in mir herum. Erst nach über einer Stunde, als ich für mehrere Minuten konzentriert in einer bequemen Stellung verweile, beginnt sich das flirrende Kreiseln zu legen. Im selben Augenblick steigen mir die Tränen in die Augen und ich muss fest auf die Lippen und die Innenseite der Wangen beißen, um zu vermeiden, dass da etwas kommt, was hier nicht herpaßt.
Drinnen tut sich etwas. Immerhin.
Montag, 21. Juli 2008
Als Maßnahme gegen den Wochenendblues habe ich die Lerngruppe mit dem Exkollegen unauffällig auf den Sonntag geschoben. Immer schön im Wechsel: einmal bei ihm und einmal bei mir. Wenn das Kind mit von der Partie ist, bleibt nicht viel Zeit zum Lernen, denn dann geht das kollektive Spielen vor. Eigentlich mache ich das auch viel lieber, baue die Briobahn zusammen, schaue Bilderbücher an und tobe durch die Wohnung.
Was also brauche ich für einen wohltuenden Sonntag?
Zwei Männer, Buddelzeug, Spielplatzlaune, Klettergeräte, Rutschbahn, Sand, Steine, Hölzer, Stöcker, echten Kuchen mit vielen Schokostückchen darin und Kaffee in Pappbechern vom Café gegenüber.

Zur Ruhe kommen und durchatmen. Das geht wohl besonders gut mit lautem Kindergeschrei, Sand in Schuhen und Haaren und der unermütlichen Aufforderung nach "mehr, mehr" ("höher, höher" / "weiter, weiter"). Auf dem Weg nach Hause fallen leichte Regentropfen und der Wind fährt mir durchs Haar, als wäre längst der Herbst angebrochen. Eine milde, etwas melancholische Ausgeglichenheit begleitet mich bis in den späten Abend.
Ein Hoch auf den alltäglichen Familienkram, an dem sie mich teilhaben lassen und auf klebrige Patschhände im Besonderen.
Sonntag, 20. Juli 2008
Ich brauche feste Termine, damit ich planen kann. Zur Sicherheit. Zur Orientierung. Selten kann ich spontan sein, kann es ertragen, wenn nicht genau feststeht: passiert / passiert nicht. Diese Unsicherheit zermürbt mich, weil sie in meinem Kopf ein ständiges Schwanken auslöst, ein Taumeln zwischen zwei Möglichkeiten, die ein Schwindelgefühl hervorrufen.
Termine machen heißt, am Morgen aufzuwachen und zu wissen, was der Tag bringen wird. Zumindest in groben Zügen. Nicht zu wissen was kommt, heißt warten. Und im Warten war ich noch nie gut. Nein, ganz im Gegenteil. Das Warten zehrt an meinen Nerven, noch bevor die Zeit herum ist, weil ich mich nicht geduldig beschäftigen kann, bis feststeht was nun passiert.
Es ist Seegang. Aber nicht mehr lange.
Montag, 7. Juli 2008
Für eine Verabredung ist langes Rumgehampel nicht zielführend und macht irgendwann nur noch bedingt Spaß. Also anrufen und mich selbst einladen, schnell, schnell, bevor ich mir wieder eine Ausrede überlegen kann. "Ich komme zu dir", sage ich hastig und er lacht leise. Keine Ablehnung, kein Gegenvorschlag und alles ist gut. War gar nicht schwer, nein, ganz im Gegenteil.
Reden und lachen und fotografieren. Das reicht um viele Stunden zu füllen. Und dann schnippel ich die Erdbeeren, er den Salat und ich drehe den Uhrzeiger auf 12 Uhr - Geisterstunde. Die Stimmung ist ruhig und entspannt und ich fühle mich wohl und vertraut, auch wenn wir uns für dieses Gefühl eigentlich gar nicht gut genug kennen. Oder doch? Ist ja auch egal, denn es macht sich einfach breit und fühlt sich gut an, ohne um Erlaubnis zu fragen.
Danke dafür!

Der Sonntag beginnt zu früh. Ich versuche zu lernen, verstehe nichts, frage Google und werde nicht schlauer. Das Unwissen macht mich erst unzufrieden, dann weinerlich, aber immerhin klingelt das Telefon - Papa ist dran. Ein Familiensonntag bei Opa? Klingt nach Ablenkung. Ich komme mit.
Ich muss nicht reden, denn diese Aufgabe übernimmt die kleine Miss. Sie erzählt Witze, liest vor, trällert ein Liedchen, macht Faxen, wirbelt durch das Wohnzimmer und lässt sich anschließend nieder, um mit dem Papa zusammen ein Geschenk für den Bruder zu basteln. Ich finde heute keine Worte, schaue ihnen nur zu, bis mir die Augen zufallen und ich für einen Augenblick anderswo bin.

Jetzt durchatmen. Und dann überlegen, welche Termine in dieser überfüllten Woche sich absagen lassen oder zumindest gekürzt werden können. Ich brauche Kraft und Energie für die wichtigen Begegnungen. Vorfreude genießen gehört schließlich auch dazu.
... nächste Seite